Max-Schneckenburger- Denkmal in Tuttlingen, 1892
 Max- Schneckenburger- Denkmal, Tuttlingen Die Photographie stammt vom Museum der Stadt Tuttlingen. |
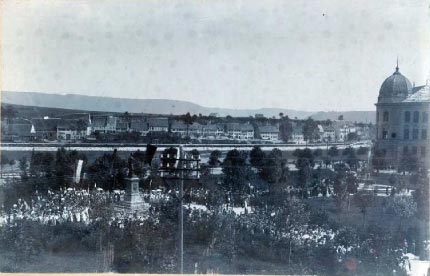 Enthüllung des Max- Schneckenburger- Denkmals 1892 im Stadtgarten von Tuttlingen. Der Prinz von Weimar hatte die Patenschaft für die Spendensammmlung übernommen. Die Photographie stammt vom Museum der Stadt Tuttlingen. |
| "Bereits
im Jahre 1878 hatte man in national gesinnten Kreisen der
Tuttlinger
Bürgerschaft den Entschluss gefasst, dem aus Talheim stammenden Dichter
Max Schneckenburger (1818-49) ein Denkmal zu setzen. Schneckenburgers
Gedicht "Die Wacht am Rhein" wurde vertont und hatte als Lied 1870/71
im Krieg gegen Frankreich ungeheure Popularität erlangt. Das erste
Denkmal, eine Germania in kämpferischer Pose, wurde 1892 enthüllt und
schon bald darauf im Ersten Weltkrieg zu Kanonen umgeschmolzen." aus: Stadtführer der Stadt Tuttlingen |
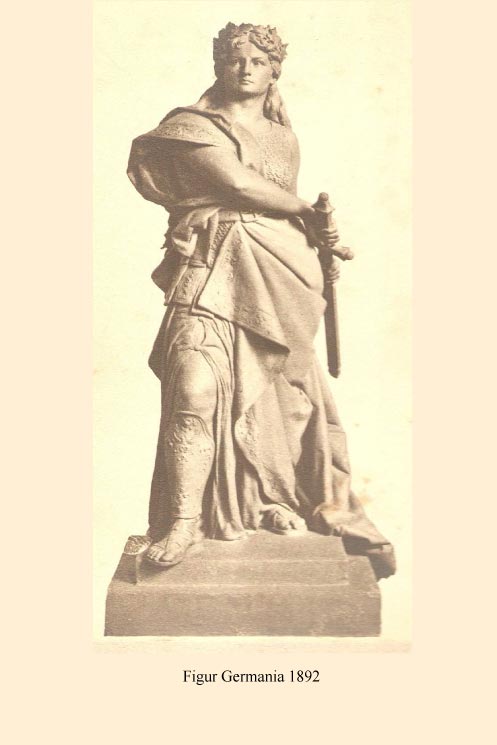 |
| "Am
19.Juni 1892 wird das Denkmal zu Ehren Max Schneckenburgers von Adolf
Jahn in Tuttlingen eingeweiht. Wiewohl es sich um ein bürgerliches
Individualdenkmal handelt, ist nicht der Autor der Wacht am Rhein
die
Hauptfigur, sondern Germania. Da über das Aussehen des Dichters kaum
etwas bekannt gewesen war, hatte der Ausschreibungstext des Denkmals
eine "schwungvolle Symbolisierung des Gedichts die Wacht am Rhein"
vorgesehen; des Textes und der Melodie, "welche dem Liede Panzer und
Schwingen" verlieh. Schneckenburgs Lied sollte also in Denkmalform
gegossen, der Text in Ikonographie übersetzt werden. Nur vom Liedtext
her ist es gänzlich unverständlich, warum "des Stromes Hüter"
ausgerechnet eine Germania sein soll. Schließlich heißt es doch in der
zweiten Strophe, daß es der "Deutsche, bieder, fromm und stark" sei,
der die "deutsche Landsmark" beschützt, und dieser Soldat wird in der
dritten Strophe mit "Er", also der dritten Person Singular maskulinum
angeredet. An keiner Stelle des Textes ist von Germania die Rede. Die
Wacht am Rhein und der Hüter des Stromes, das ist der Deutsche
beziehungsweise die Deutschen, denn Max Schneckenburger überführt in
der fünften Strophe den Singular in den Plural:"Wir alle wollen Hüter
sein!" Und dennoch ist die Hauptfigur des Denkmals nicht ein Soldat,
sondern die allegorische Frau Germania. Somit sind bei dem Tuttlinger
Denkmal zwei Eigentümlichkeiten eine Liaison eingegangen. Erstens die
Errichtung eines bürgerlichen Individualdenkmals ohne zu ehrendes
Individuum, und zweitens die Transkription eines Textes in metallene
Form, wobei ein Darstellungstypus erwählt wird, der sich nicht zwanglos
aus der literarischen Vorlage ergibt. War man etwa der Überzeugung, daß
ein beliebiger Soldat nicht in der Lage sei, den heiligen Strom zu
hüten, meinte man, eine größere Schutzmacht in Gestalt einer Germania
aufbieten zu müssen? Oder lag es daran, daß ein Soldat exkludierende
Effekte gezeigt hätte, denn: in welcher Uniform, mit welchem
Rangabzeichen hätte er dargestellt werden sollen, welchem Regiment
müßte er angehören und derlei Fragen mehr? Nun, offensichtlich hielt
man die Leerstelle Germania für die Visualisierung des "Wir alle"
wesentlich geeigneter. Die Exclamatio "Wir alle wollen Hüter sein!" war
nicht nur mobilisierend sondern auch integrativ gedacht. "Wir all", das
war die deutsche, wehrhafte Nation, die sich auf die "Heldenväter" in
den "Himmels Au`n" bezog, und dieses Kollektiv verkörpert sich in
Gestalt der Germania, die, auch wenn die letzten Töne der Wacht am
Rhein verklungen
sein mögen, die deutsche Nation zur Wachsamkeit und zum gerechten
Streite mahnt. Schwungvoll scheint sie das Schwert aus der Scheide zu
ziehen, das rechte Bein ist leicht angewinkelt und nach vorne gesetzt.
Der Liedtext, das Portraitmedaillon und sowie die wenigen Attribute der
Jahnschen Allegorie bilden ein komplexes Verweisungssystem. Das
Individualdenkmal mutiert zum nationalen Denkmal. In Germania und erst
dann in Schneckenburger feiert sich die Nation selbst und singt solch
passende Lieder wie `Richte Dich auf, Germania´ und `Hurrah Germania´.
Vielleicht aber unterliegt dem Tuttlinger Germaniadenkmal auch ein
geheimes Zitiersystem, das die Wahl der Allegorie erklären könnte. Neun
Jahre zuvor war das Niederwalddenkmal eingeweiht
worden, dessen Hauptfigur ebenfalls eine Germania ist. Auf dem Sockel
ist der unvollständige Text von Schneckenburgers Lied eingraviert. Auf
der dortigen Einweihungsfeier wurde unablässig betont, daß die
Rüdesheimer Germania die Wacht am Rhein hält. Was läge näher, als die
Wacht am Rhein beim Tuttlinger Ehrenmal ebenfalls in Gestalt der
Allegorie zu modellieren?" aus: Lothar Gall, 1993: Die Germania als Symbol nationaler Identität im 19. und 20. Jahrhundert, Bibliothek der Universität Halle |
| Frau Moll vom Museum der Stadt
Tuttlingen schickte mir
dankenswerterweise das Bild des 1892 aufgestellten und 1918 abgebauten
Denkmals und das Bild von der Einweihung des Denkmals, sowie den Text
aus dem Stadtführer der Stadt Tuttlingen. Es existieren nach Aussage von Frau Moll noch einige kleinere Kopien der Germania- Figur. Eine davon steht vor dem Max- Schneckenburger Haus in Talheim (Kreis Tuttlingen), dem Geburtshaus von Max Schneckenburger. Herr Hall, Bürgermeister von Talheim, stellte mir die folgenden Bilder der Statue zur Verfügung. |
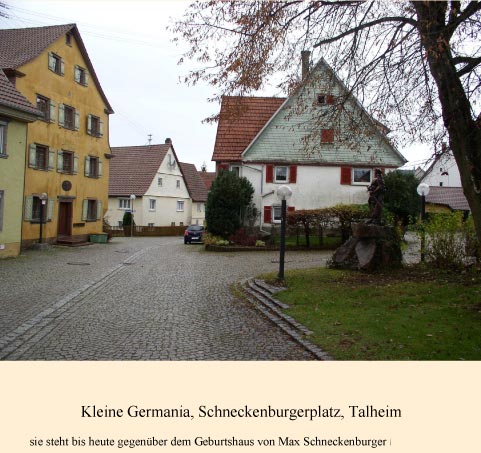 |
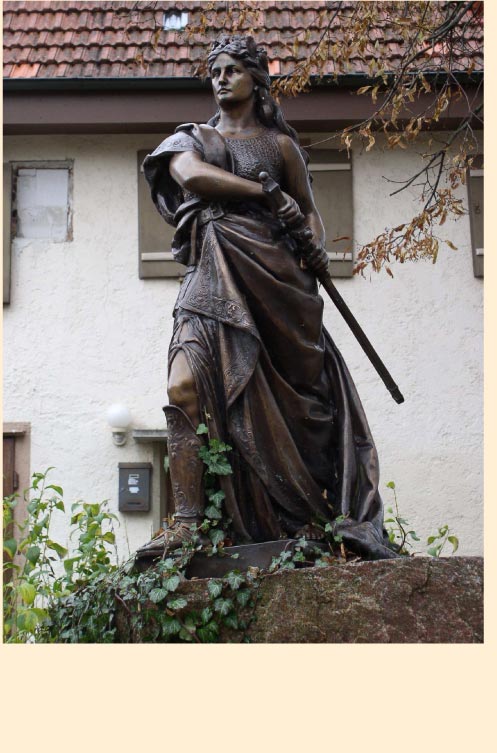 |
 |
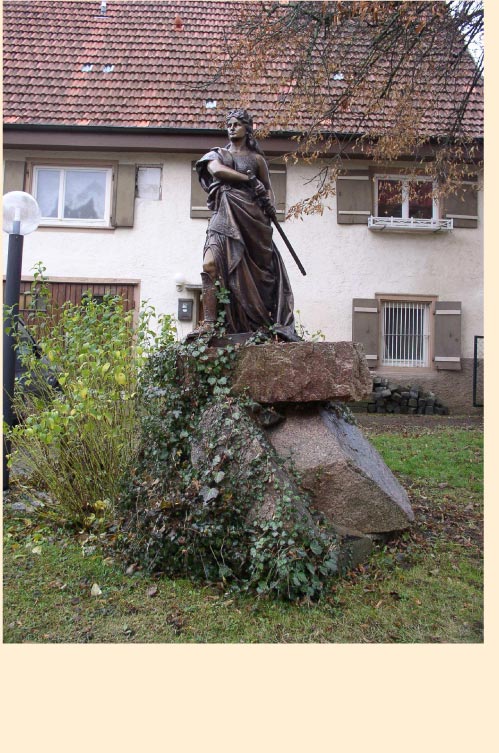 |
zum Seitenanfang
